Enzyklopädische Erklärungen tun das Phänomen „Déjà vu“ als Täuschung des Gedächtnisses ab. Was dabei genau geschieht, ist einschlägiger Wissenschaft nicht klar; sie sieht eine Korrelation zu Erkrankungen. Mystiker verweisen auf Begebenheiten „in einem früheren Leben“. Ich bliebe lieber bei real auffindbaren Zusammenhängen. Cees Nooteboom, niederländischer Autor, sagt, Erinnerung sei „wie ein Hund, der sich hinlegt, wo er will“. Unzählige Beispiele für optische, akustische und kognitive Täuschungen belegen, wie uns das Gehirn irreleitet. Nootebooms Landsmann Douwe Draaisma hat einige lesenswerte Bücher zum Thema verfasst, die ich gern empfehle.1
Déjà vu erscheint weniger rätselhaft, wenn man dem Gedanken folgt, dass „Gedächtnis“ keine Ablage von Erinnerungen ist wie ein Archiv, eine Bibliothek oder irgendein Datenspeicher, sondern die ununterbrochene Bewegung eines ganzen Universums von Möglichkeiten, das sich dem realen Geschehen überlagert. Ich stelle mir eine riesigen Menschenmenge vor, darin jeder einzelne mit Reden und Handeln beschäftigt, die ich durchquere. Die ganze Zeit über empfängt mein „leibliches Gedächtnis“ – Körper und Geist untrennbar miteinander verbunden – chaotisch Eindrücke aus dem Geschehen um mich herum, aber nur bei bestimmten, musterhaften, verdichten sich die Signale zum Impuls des Erkennens. Und dieses „Erkennen“ ist nicht zwangsläufig an vorausgegangenes eigenes Erleben gebunden, sondern an die genetisch bedingte Kompositionsweise der Musterkennung, an eine unüberschaubare Menge von Antizipation strategischer Wendungen, deren sich niemand bewusst sein könnte, die sich nie kausal ordnen, geschweige beherrschen ließen.
So gesehen wäre erklärbar, weshalb und wie wir träumen. Manche reden davon, etwas sei ihnen „in einem früheren Leben“ widerfahren. Tatsächlich unterscheidet das Gedächtnis nicht immer scharf zwischen real oder nur im Film, im Traum, beim Lesen oder aus dem Hörensagen empfangenen Inhalten – allerdings trennt es wichtig und unwichtig in existenziellen Situationen viel schneller als es das Bewusstsein könnte. Das kann auch schief gehen, denn die antizipierte Gefahr ist womöglich gar keine – aber Schnelligkeit geht vor, antizipiert wird „quick’n dirty“.
Weshalb schreibe ich diese längliche Vorrede zu einem kurzen Text – recht eigentlich einer Farce oder einem Guignol? Weil die enormen Informationsmengen, mit denen Menschen hier und heute überflutet werden, fast ausschließlich auf ihre Inhalte hin und auf ihren vermeintlichen Gehalt an Realität betrachtet werden. Das Wort „Fakten“ wurde zu einer Monstranz, die all diejenigen vor sich hertragen, die ihre Form der Informationsvermittlung gern unangreifbar machen möchten. In den herkömmlichen ebenso wie in den neuen, „sozialen“ Medien toben unerbittliche Kriege um Wahrheit oder Lüge, redliche Information oder „manipulierte“, um die Deutungshoheit zwischen Gut und Böse, falsch und wahr.
So weit, so anthropologisch konstant. Begleiten Sie mich nun einmal – spaßeshalber – in die Welt der Träume. Dort sind Regeln der Logik und Kognition weitgehend außer Kraft. Nicht so die Antizipation, nicht die Antriebe zum Erlangen und Vermeiden, weder Ängste noch Lüste: Dort finden sich Konflikte ebenso wie Erlösendes, Beglückendes. Ich erlebe immer wieder einmal Schwerelosigkeit, kann schweben, stürze auch ab ins Leere, ohne Furcht vorm Aufschlag übrigens.
Wie kostbar diese jenseitigen Welten sind! Das Gehirn befasst sich dort nur noch eingeschränkt mit unmittelbaren Reizen; es wird vom Unbewussten, vom Erinnern, von Wünschen und Ängsten bewegt. Es muss ihnen folgen in gegenstandslose, phantastische, manchmal furchterregende Geschehnisse. Was im Alltag nicht zu merken ist – dass hinter Entscheidungen nur selten vernünftiges Abwägen steht – wird hier und jetzt universelles Programm. Alles ist möglich. Es muss nur einen Kondensationskeim geben, an den sich chaotisch schweifende Erinnerungen anheften können, egal ob sie frühkindlichem Erleben oder einer Fernsehserie entspringen. Von diesem Keim aus vernetzen und verweben sich Landschaften, Figuren, Situationen innerhalb von Hundertstelsekunden. Sie sind flüchtig, aber sie können stärker wirken als real Erlebtes.
Jeder, der Katzen oder Hunde hält, kann sie ab und zu beim Träumen beobachten, und jeder Neurophysiologe kann Ihnen heutzutage erklären, um was für eine wichtige Lebensfunktion es sich handelt. Gleichwohl rätseln Wissenschaftler immer noch daran herum, was Menschen in Morpheus‘ Umarmung geschieht. Interessant wird es, wenn das Bewusstsein für einen kurzen Moment in den Traum „hineinspringt“ – etwa um zu sagen „Du träumst ja nur!“ Man weiß heute, das manche Menschen in sogenannten Klarträumen Inhalte sogar beeinflussen können. Zweifellos existieren Übergänge zwischen Traum und Kognition, sonst kämen keine Gesprächsfetzen, gar Dialoge (allerdings von der schrägen Sorte) vor. Sich daran erinnern zu wollen, produziert wieder nur Bruchstücke, und bisher war nie jemand in der Lage zu überprüfen, inwieweit sie mit dem Geträumten tatsächlich übereinstimmen.
Hirnforscher wollen aufklären, was da “wirklich” geschieht. Sie wollen mittels hochpräziser Messung elektromagnetischer, hormoneller, zellbiologischer Abläufe die Traum- und Gedankenwelten vermessen. Aber dieses “wirklich” bedeutet doch immer nur, dass mit apparativ begrenzten Methoden Daten erfasst und Modelle konstruiert werden. Diese Modelle müssten in irgendeiner Form verifizierbar sein – etwa indem man aus mit ihrer Hilfe entworfenem elektromagnetischen Geschehen einen vorhersagbaren Traum entstehen ließe, also – wie im Film „Inception“ – bewegte Bilder ins Traumgeschehen einspielte, dem der Träumer nicht entfliehen kann.
So etwas ist Wunschvorstellung aller Despoten, Geheimdienste, vieler Produzenten mehr oder weniger schlechter Sci-Fi-Texte, Filme, Spiele. Vermutlich steckt schon viel Geld in einschlägigen Forschungen. Ihre Konsequenzen gehen – was ökonomische und politische Macht anlangt – über Kernkraft, Gentechnik, IT und Internet hinaus. Sie verschärfen alle Fragen nach menschlicher Verantwortung bis tief ins Persönliche. Aber stirbt infolge solcher “digitaler Transparenz” des Individuums nicht jedes Vertrauen, sogar das zu sich selbst?
Damit bin ich beim déjà vu meines Guignols von 1988 und einer sehr erfolgreichen Methode der Stasi: Dem „Zersetzen“ von Persönlichkeiten – im Sprachgebrauch des Mielkeschen Liebesministeriums „Personen mit feindlich-negativer Einstellung“. Fürsorge und Abhängigkeit, das Spiel mit Misstrauen, ritualisierte Bekenntnisse, der Wechsel von Drohungen und Heilsversprechen, Einschwören auf gemeinsame Feinde, Gesinnungskitsch: Das alles findet sich im Alltag heutiger Kämpfe um die Deutungshoheit, also die informelle Macht.
Mir half damals „Das Bündnis“, mich nicht „zersetzen“ zu lassen. Das déjà vu erheitert und erschreckt zugleich, denn die Methoden sind im Schwange; noch ist es allerdings möglich, sich zu wehren.
Weiter zu „Das Bündnis – eine Farce“
1 Douwe Draaisma: Das Buch des Vergessens. Warum unsere Träume so schnell verloren gehen und sich unsere Erinnerungen ständig verändern. Aus dem Niederländischen von Verena Kiefer. Galiani, Berlin 2012
Warum das Leben schneller vergeht, wenn man älter wird. Von den Rätseln unserer Erinnerung. Aus dem Niederländischen von Verena Kiefer. Eichborn, Frankfurt am Main 2004.
Der Artikel ergänzt die Veröffentlichung auf „Acta Litterarum“










 allem weißen – vorbehalten sein soll. Ihre Methoden sind subtiler. Sie sind körperlich unterlegen, blutige Rache wie in ‚Kill Bill‘ wird kaum eine üben. Dazu bräuchte es auch eine Energie und Hartnäckigkeit, wie sie nur ein Filmautor mit der Phantasie Quentin Tarantinos ersinnen kann. Die reale
allem weißen – vorbehalten sein soll. Ihre Methoden sind subtiler. Sie sind körperlich unterlegen, blutige Rache wie in ‚Kill Bill‘ wird kaum eine üben. Dazu bräuchte es auch eine Energie und Hartnäckigkeit, wie sie nur ein Filmautor mit der Phantasie Quentin Tarantinos ersinnen kann. Die reale 

 „Guten Tag, Leo.“ Der Strauß landet in der ausgestreckten Hand. „Oh wie schön. Das wäre doch nicht…“ Wir lachen beide los. Die Distanz ist wieder weg. Sie umarmt mich und küsst mich auf beide Wangen. „Komm rein, Kachelmann, du kannst offenbar Wetter nach Wunsch machen.“ Hinter mir schließt sich lautlos die Glastür, innen ist Park wie außen, nur das Allerheiligste liegt hinter hohen Wänden aus kostbarem Holz.
„Guten Tag, Leo.“ Der Strauß landet in der ausgestreckten Hand. „Oh wie schön. Das wäre doch nicht…“ Wir lachen beide los. Die Distanz ist wieder weg. Sie umarmt mich und küsst mich auf beide Wangen. „Komm rein, Kachelmann, du kannst offenbar Wetter nach Wunsch machen.“ Hinter mir schließt sich lautlos die Glastür, innen ist Park wie außen, nur das Allerheiligste liegt hinter hohen Wänden aus kostbarem Holz. „Was? Nein, doch. Besser, wir gehen auf die Terrasse. Nimmst du Flasche und Gläser mit?“ Lautlos öffnet sich eine der Glaswände. Wir stehen im Park. Die Sonne malt aus Zirruswolken rote Arabesken in den Abendhimmel. Im leichten Wind umspielt das Tüllkleid ihre Beine. Sie ist wunderschön. Was wäre passiert, wenn ich sie angelogen hätte, statt eines Witwers für sie ein alter Hagestolz geblieben wäre? Ich zünde mir einen Zigarillo an. Was sollte diese Frau, mit der mich nichts verbindet als ein heftiges erotisches Abenteuer vor Jahrzehnten, an meinem Leben interessieren? Wieso bin ich hier? Was will sie?
„Was? Nein, doch. Besser, wir gehen auf die Terrasse. Nimmst du Flasche und Gläser mit?“ Lautlos öffnet sich eine der Glaswände. Wir stehen im Park. Die Sonne malt aus Zirruswolken rote Arabesken in den Abendhimmel. Im leichten Wind umspielt das Tüllkleid ihre Beine. Sie ist wunderschön. Was wäre passiert, wenn ich sie angelogen hätte, statt eines Witwers für sie ein alter Hagestolz geblieben wäre? Ich zünde mir einen Zigarillo an. Was sollte diese Frau, mit der mich nichts verbindet als ein heftiges erotisches Abenteuer vor Jahrzehnten, an meinem Leben interessieren? Wieso bin ich hier? Was will sie?
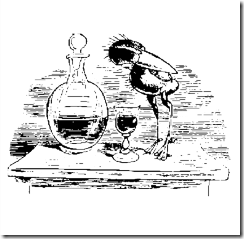
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.