 Am 26. April werden es zehn Jahre, dass Robert Steinhäuser, ein 19jähriger Erfurter, sich schwarz maskierte, sich mit einer Pistole Glock 17, 9mm und einer Pumpgun bewaffnete, in das Gymnasium ging, aus dem ihn eine ums Renommee ihrer Schule besorgte Direktorin ein halbes Jahr zuvor hinausgeworfen hatte.
Am 26. April werden es zehn Jahre, dass Robert Steinhäuser, ein 19jähriger Erfurter, sich schwarz maskierte, sich mit einer Pistole Glock 17, 9mm und einer Pumpgun bewaffnete, in das Gymnasium ging, aus dem ihn eine ums Renommee ihrer Schule besorgte Direktorin ein halbes Jahr zuvor hinausgeworfen hatte.
Er erschoss zwölf Lehrer, die Sekretärin, zwei Schüler, einen Polizisten, dann sich selbst. Die Bluttat mündete in die solchen Taten zwanghaft folgenden Sozialrituale. Trotz anschwellender Medienverstärkung haben diese Rituale das nächste Massaker nie verhindert, sie werden es – fürchte ich – auch künftig nicht tun. Das liegt vor allem daran, dass nach einem “Warum” gefragt wird, aber nicht nach dem Ziel des Täters, nicht nach den Handlungsimpulsen, die auf dieses Ziel fixiert sind. In einer Gesellschaft, die sich fast ausschließlich darum bemüht, den Fortgang der je eigenen Geschäfte sicher-zu-stellen, anderen also die Zukunft zu verstopfen, werden zwangsläufig diejenigen übersehen, denen die Zukunft verstopft wird. Nicht alle schießen sie sich frei.
Die folgende Geschichte ist persönliches Nachdenken zum Thema.
Weshalb ich dieses Geschehens in meiner Erinnerung so sicher war? Ich weiß es nicht. Es gab keinerlei gefestigte Daten, keine verlässlichen Zeugen, keinen Ort auf dem Friedhof, der hätte beglaubigen können, dass dieser Selbstmord sich 1968 wirklich ereignet hatte, aber ich hätte Stein und Bein darauf geschworen. Meine Sicherheit stützte sich seltsamerweise auf Schreckenstaten der jüngsten Vergangenheit: auf die Erschießung von Jugendlichen – fast nur Mädchen – durch einen Mitschüler in Winnenden im März 2009, auf ein ebensolches Blutbad unter Lehrern in einem Erfurter Gymnasium am 26. April 2002, auf brutale Übergriffe von Jugendlichen in den USA wie hierzulande. Sie stützte sich vor allem auf ein Gesicht – es ähnelte den Gesichtern der beiden Schulselbstmörder: es war rund, eher kindlich als markant, von blonden Haaren umrahmt, die zu lang waren, als dass sie nicht seinerzeit das Missfallen von Lehrern und FDJ-Funktionären erregt hätten.
1968 war das, und der 17jährige, der zu diesem Gesicht gehörte, war ein unauffälliger, zurückhaltender und nicht etwa für seine Aggressivität bekannter Schüler. Unauffällig, eher angepasst – wie die Selbstmord-Attentäter von Erfurt und Winnenden. Er war ganz anders als ich. Während meiner Schulzeit, vor allem in den letzten Jahren bis zum Abitur, fiel ich andauernd auf: durch Unbotmäßigkeiten, Pausenclownerien, Stören im Unterricht, politische Äußerungen, deren feindlich-negativer Charakter alsbald durch eine aufmerksame Mitschülerin der Schulleitung hinterbracht und in Akten der einschlägigen Behörde verewigt wurde. Aber meine Lehrer warfen mich nicht hinaus. Sie hielten mich für einen hellen Kopf; sogar der Parteisekretär, der es später zu einem hohen Posten in der Bezirksleitung der SED bringen sollte, sah durch die Finger. Ich hatte Glück. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen.
Denn dieser andere, stille Junge war ungeschützt, als sie ihn hinauswarfen. Anders als ich hatte er nicht den ganzen Wissenskanon der marxistisch-leninistischen Fächer drauf; er beteiligte sich weder an Mathematik- noch an Russischolympiaden. Er war den Zensuren nach durchschnittlich und – so sagte mir die Erinnerung – weder Rebell noch romantisches Sensibelchen, aber dann brachte er sich um. Er tat das wegen des Verweises „von allen Erweiterten Oberschulen der DDR“, einer Strafmaßnahme, die gleichbedeutend mit dem Ausschluss von so gut wie jeder Studienmöglichkeit war. Er tat es, weil ihm damit die Welt zusammenbrach. Aber wofür der Hinauswurf?
Der junge Mann hatte auf dem Tanzboden – also in aller Öffentlichkeit – ein T-Shirt mit dem Union-Jack getragen, ein Mitbringsel der Westverwandtschaft vielleicht oder eines der Großmutter von einem Besuch im Reich des Klassenfeindes, der Aufmerksamkeit der Sicherheitsorgane entgangen, durchgerutscht, begeistert aufgenommen vom jugendlichen Fan englischer Musikgruppen, stolz vorgezeigt beim Schwof, bunte Feder beim Balzspiel vor den Hübschen, die ihn sonst immer übersehen hatten. Das hatte der sonst Unauffällige gewagt – und verloren. Jemand hatte ihn angeschwärzt, er war geflogen. Daran meinte ich mich zu erinnern.
Nur um kurzzeitig jungen Mädchen zu imponieren, hatte er einen entsetzlichen Preis gezahlt: seine ganze Zukunft. Denn die DDR war sieben Jahre nach dem Bau der Mauer der einzige Ort, wo es für ihn eine Zukunft gegeben hätte, es gab kein anderswo, kein danach. Den Traum von Gegenden, über denen der Union-Jack statt Hammer und Zirkel im Ährenkranz auf Schwarz-Rot-Gold wehte, durfte er nicht einmal träumen. Unentrinnbar gesichert durch Minen und Stacheldraht wartete der Alltag im sozialistischen VEB auf den vom Studium Ausgeschlossenen. Diesen Alltag hatten wir Oberschüler schon kennen gelernt, denn wir gehörten zu den Jahrgängen, denen zum Abitur der Erwerb eines Facharbeiterbriefs – vulgo Gesellenprüfung – verordnet war. Wir tauchten alle drei Wochen in einem Betrieb auf, meistens freuten sich die dort Beschäftigten, dass wir für alle liegen gebliebenen, unangenehmen Arbeiten eingeteilt werden konnten. Der Tonfall, mit dem der Werkstattleiter seinerzeit die Worte „Oberschüler“ und „Zukunftsingenieure“ artikulierte, ist unvergessen.
Diese Zukunft war der Tod. Es war die Aussicht aufs unabänderliche Ritual allmorgendlichen Weckerklingelns, trostloser Transporte in stinkenden Bussen, erzwungener Gemeinschaft im „Kollektiv“, die um so schlimmer war, als sie andauernd zu erwünschter Gemeinschaft umgelogen wurde, es war die Aussicht, sich in den nächsten achtundfünfzig Jahren totzuschuften für den Sieg des Mauersozialismus und dabei mit einem Brandmal herumzulaufen oder zumindest so lange eine Maske überzustreifen, bis dieses Mal in Vergessenheit geriet. Es wunderte mich nicht, dass der junge Mann mit dem kindlichen Gesicht unterm blonden Schopf vor dieser tödlich verstellten Zukunft kapituliert, sich einen Strick genommen und im Stadtpark erhängt hatte.
Während meiner Zeit in der DDR fragte ich mich selbst immer wieder einmal nach dem Sinn eines Weiterlebens nach Hinauswürfen, Berufsverbot, „Zersetzungsmaßnahmen“ von Stasis. In meiner Umgebung nahmen sich mehrfach junge Menschen das Leben: eine Frau von Anfang 20, die nicht zu ihrem nach Westberlin geflohenen Freund ausreisen durfte, ein exmatrikulierter Schauspielstudent. Diese Tode zur Unzeit enthielten für mich immer Botschaften: „Da ist nichts und niemand mehr, die es wert wären, am Leben zu bleiben“, war eine. „Ich gehe in den Tod, damit ihr die Welt ändert“, eine andere. Die sie als lebende, sterbende Fackeln in die Öffentlichkeit trugen wie der Student Jan Palach, der Pastor Oskar Brüsewitz, wie buddhistische Mönche derzeit in Tibet, die damit das von der Kommunistischen Partei verordnete Schweigen brachen, erschütterten mich; die im Stillen gingen, waren mir näher in ihrer Ohnmacht zur Verzweiflung; ihnen gegenüber fühlte ich mich mitschuldig, weil mein Leben – wenn auch von Konflikt zu Konflikt – weiter funktionierte. Die Partei fürchtete selbst die leisen Abschiede: Ab 1963 wurden alle Statistiken zu Geheimpapieren, 1977 wurde das Verbot, über Suizide zu publizieren, noch einmal verschärft. Jeder Suizid schlug den Glücksverheißungen für alle, der ultima ratio des Kommunismus den Boden weg. Dafür hätten die Funktionäre immer noch wohlfeile Erklärungen mit „psychischer Labilität“ oder „persönlicher Tragödie“ parat gehabt; was sie wirklich scheuten, waren nachprüfbare statistische Daten. Diesen Daten nach lag die Rate der Suizide in der DDR erheblich höher als im Westen. Die Funktionäre sahen sie als Munition für den Klassenfeind.
Inzwischen sind Selbstmorde öffentliches Gemeingut. Sie werden umso lieber publiziert und in Massenmedien breit getreten, je prominenter die Toten, je ausgefallener die Todesarten; noch ausführlicher und mit noch größerem finanziellen Gewinn, wenn es „erweiterte Selbstmorde“ sind, also Angehörige oder Unbeteiligte mit in den Tod gerissen werden. Der Chor der – mal klagenden, mal empörten – Kommentare singt inbrünstig „Warum?“ dazu, hingebungsvoll schmücken Fachleute und solche, die sich dafür halten, die jeweilige Vorgeschichte aus. Beinahe immer tauchen darin Wendungen wie „still“, unauffällig“, „höflich“, gar „freundlich“ auf. Man konnte nichts ahnen. Man darf sich unbeschwert in der Sicherheit wiegen, derlei nicht vorhersehen, geschweige verantworten zu müssen.
Gerade deshalb erschien der Tod meines blonden Mitschülers vor 40 Jahren meinem Gedächtnis unzweifelhaft, es war ihm auch buchstäblich noch einmal einverleibt worden bei der Lektüre meiner Stasiakte 1991. Ich fand zwar keinen Hinweis auf den unglücklichen Kameraden, aber alle Denunziationen aus der Schulzeit, gottlob auch Zeugnisse der Loyalität meiner Lehrer. Ich zweifelte nicht, dass ich Glück gehabt hatte, dass ich – wenigstens zeitweise – davon gekommen war, anders als der Erhängte. „Du bist davongekommen“, sprach mein Gewissen, „hast du das verdient?“
Genau dieses Gefühl stellte sich bei mir wieder ein, als ich das Gesicht des kleinen blonden Jungen sah, der einmal Robert Steinhäuser gewesen war. Die Schuldirektorin mit der straffen Frisur, mit den schwarz geschminkten, unnachsichtigen Augen hatte ihn kurz vorm Abitur hinaus geworfen. Freilich war er da kein Kind mehr, sondern ein 19jähriger mit massivem Kinn, kurzem Haar, kräftigem Körper. Seine Zukunft – jedenfalls das, was er sich davon erhoffte – war vom Verdikt der staatsgewaltigen Dame verstellt. Die Türen waren zu, er stand draußen. Er ging nur scheinbar still und leise davon, er schrieb sich wenig später umso gewaltsamer in die Zukunft ein, die ihm von der Beamteten verweigert, vernichtet worden war. Er wendete seine ganze Phantasie, seine Fähigkeit zu planen, seine aggressive Energie auf dieses Ziel. Er erreichte es. Niemand wird ihn vergessen, niemand das inzwischen aufwendig renovierte Schulgebäude betreten, ohne früher oder später an das Massaker vom 26. April 2002 erinnert zu werden. In dem gewaltigen Gedröhn, das sich damals in den Medien erhob, blieb immer vernehmlich der „Warum?“- Chor. Die Litanei war genauso wenig auf beunruhigende Antworten aus wie nach dem Massaker von Winnenden im März 2009.
Das ist, was mein Unbehagen ausmacht: dass immer wieder die Fragen gestellt werden, die beschwichtigende Antworten schon vorwegnehmen. Jener Mitschüler in der DDR 1968 hatte keinen Zugriff auf Schusswaffen. Wäre er an eine Kalaschnikow gekommen, wäre die Sache anders ausgegangen: er hätte sich seine Zukunft freigeschossen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Immerhin hatte er in dieser Richtung keine Vorbilder.
Damit genug der Spekulationen: Mein Gedächtnis hat mich – das macht mein Unbehagen nur schlimmer – gnadenlos belogen. Den erinnerten Selbstmord wegen eines T-Shirts mit Union-Jack hat es nicht gegeben. Es gab Hinauswürfe aus der Oberschule, es gab einen Selbstmord, beides hatte nichts miteinander zu tun. Die von unserem Bewusstsein für jegliche Erklärung gern herangezogene Kausalität, die Frage „warum“ hatte auch mich getäuscht. Ich war dem scheinbar einfachen, klaren Bezug von Ursache und Wirkung aufgesessen, dem ich sonst so nachhaltig misstraue: eine dem politischen System zuzurechnende Erniedrigung treibt einen Jugendlichen in den Selbstmord.
In Wahrheit war der Selbstmörder damals vor 43 Jahren – wie es für die meisten Suizidenten zutrifft – ein 17jähriger, dessen Psyche altersbedingten Krisen nicht gewachsen, der dann einem heftigen Konflikt ohne politischen Hintergrund hilflos ausgeliefert war. Er war unglücklich verliebt, sein Elternhaus war schlecht beleumdet, er fühlte sich von Altersgenossen abgelehnt, heute würde man sagen “gemobbt”.
Von dem außerordentlich gründlich recherchierten Buch „In einem Anfall von Depression …“ des Leipzigers Udo Grashoff habe ich mich belehren lassen, dass solche Konstellationen eine Selbsttötung bei Jugendlichen begünstigen, dass Rückhalt im Elternhaus, in der Religion oder andere verlässliche soziale Netze sie verhindern – wenn sich ein Ausweg findet im Ausweglosen, ein Trost im Schmerz, wenn da andere Ziele sind als das Ende mit Schrecken, wenn dem Zug in die Tiefe, dem „Spring doch einfach!“ ein innerer Halt entgegensteht – oder auch nur ein Fluchtweg offen bleibt. Grashoff weist nach, dass schon vor dem Zweiten Weltkrieg die Zahl der Selbsttötungen in den Regionen der nachmaligen DDR traditionell deutlich höher gelegen hat als im Westen, vor allem als in den katholischen Landstrichen des Westens.
Sehen wir einmal davon ab, dass dem Arbeiter- und Bauern-Staat vermutlich viele potentielle Selbstmörder einfach entflohen sind; in den 50er Jahren gingen – so sagt auch das Buch von Grashoff –, die für sich keine Zukunft im SED-Staat sahen, einfach gen Westen, wo sie eine Zukunft hatten oder auch nicht. Falls sie im Westen doch noch Hand an sich legten, sind sie statistisch nicht spezifisch erfasst; jedenfalls blieb die Zahl der Selbsttötungen in der Bundesrepublik weit unter derjenigen im Osten. Nach dem Bau der Mauer nahmen Selbsttötungen namentlich unter den Jugendlichen der DDR noch einmal stark zu. Später normalisierten sie sich; insgesamt lässt sich dennoch keine einfache Kausalität zwischen politischer Repression und Suizidalität herstellen.
Dass die Frage, wann einer aus seinen Konflikten nicht mehr herausfindet, wann er das Ende mit Schrecken der Fortexistenz unter Qualen vorzuziehen beginnt, also ernsthafte Vorsätze in Richtung Suizid fasst, dennoch mit seinem Verhältnis zu eigenen und den Zielen seiner sozialen Umgebung zu tun haben muss, bedarf keiner wissenschaftlichen Beglaubigung. Dass sich eine derart existenzielle Krise nicht auswirkt auf die Art wie er kommuniziert, mag glauben, wer da will.
„Was wird aus mir? Was ist der Sinn meines Daseins?“ – Ich kenne fast niemanden, der sich das als junger Mensch nicht gefragt und tiefe Zweifel durchgemacht hat. Wenn einer sich als Alternder wieder damit auseinandersetzt, hat sich die Perspektive vollkommen geändert, auch die Kommunikationsweise. Und deshalb lande ich wieder bei den Gesichtern, denen man angeblich Probleme nicht ansieht, beim „unauffälligen“ und „sozialkonformen“ Auftreten. Ich lande bei dem Erziehungsprinzip, das jungen Leuten vorhält: „Was andere können, kannst du doch auch – oder?“ Das „oder“ ist eine Drohung.
Unheilvoll dräut hinter diesem Wort, was einem oder einer passiert, die nicht kann, nicht will, was alle anderen können, also wollen können und dann auch tun: sich anpassen, sich konform verhalten. Es ist ein deutlich auferlegter Zwang, nicht abweichend und eigensinnig zu agieren, sondern dem Mainstream gemäß. Wenn Sie mögen, dürfen Sie an dieser Stelle einen Katalog von Marken für die Kleidung, Schulfächern, Studienrichtungen und Karrierezielen einfügen, der dem Nachwuchs die erfolgreiche Zugehörigkeit zum „freundlichen“, „unauffälligen“, „erfolgreichen“ Dasein im Mittelstand sichert. Die Liste ist lang. Man muss sich sehr anstrengen, um mitschwimmen zu dürfen bis zum Abitur und zur Karriere. Man nennt das Lebensplanung.
Diese Lebensplanung steht in einem perversen Widerspruch zur öffentlichen Aufmerksamkeit. Wer wahrgenommen werden will in unsrer von Medien durchströmten Welt, wer mitsurfen will auf der alle Seiten des Internets und der Zeitungen sowie die Kanäle von Fernsehen und Rundfunk durchtosenden Welle, der muss spektakulär sein, überlebensgroß. Er oder sie kann sich hochdienen über Castingcouches oder -shows – das kann schnell gehen –, hinaufquälen oder -dopen auf Leistungssportgipfel – das dauert länger –, sich auf die jahrzehntelange Ochsentour der Parteienkarriere begeben. Wem man zu diesen Höhen frühzeitig, viel zu frühzeitig für besonnenes Abwägen, ob sich derlei wirklich lohnt, den Weg versperrt, wen man noch dazu deutlich das Versagen bei der Anpassung spüren lässt: „Wenn andere das können – wieso kannst du das nicht?“ – der kann aber auch einfach, um sehr schnell berühmt zu werden, die Welt samt der von anderen vorgegebenen Zukunft in die Luft jagen.
Dann brandet die Medienwoge hoch, man ist bestürzt oder betroffen, man staunt, dass, was so unauffällig und angepasst schien, so explodieren konnte.
Viktor Frankl, jüdischer Psychologe, überlebte Konzentrationslager und Drittes Reich. Er hat einmal den Unterschied zwischen Totalitarismus und Konformismus, den er für das größte Übel unserer Zeit hielt, auf den Satz gebracht, das eine bedeute: zu tun, was die anderen wollen, das andere: zu wollen, was die anderen tun. „Wenn die anderen das können …“
Sich selbst zu töten, ist eine Extremform von Kommunikation. Wer da ohne Spektakel freiwillig aus dem Leben geht, hinterlässt die Botschaft, dass ihn keine Bindung an einen anderen Menschen mehr hält. Vielleicht erscheint ihm das nur für einen Moment so, vielleicht ist das eine vom Psychiater zu diagnostizierende krankhafte Wahrnehmungsstörung. Vielleicht erleben viele junge Leute so etwas und überleben es. Die Statistik sagt, dass heute, zwanzig Jahre nach dem Ende der DDR weniger Jugendliche sich umbringen, das tun eher die Alten. Die gewalttätig – auch gegen sich selbst – handeln, die anderen ihre Zukunft zerschlagen, die „Selbstmord-Attentäter“, die modernen Medien-Eklatisten, werden mehr. Das ist eine beunruhigende Bestätigung der Worte von Frankl. Seine Schrift zum Thema heißt „Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn“.
 Schon nach kurzem Einlesen erstaunte mich die Recherchearbeit, die Regine Igel für ihr Buch geleistet hat. Ein enormes Puzzle von Zeiten, Orten, Personen tat sich auf, zusätzlich kompliziert durch Lücken und Schwärzungen in den Archivalien aus Stasi-Unterlagen, die man ihr beim BStU herauszugeben bereit war. Die größte Komplikation liegt freilich im Wesen der Sache: „Terrorismus-Lügen“ sind mehr als die gängigen Deckmäntel überm Agieren der Stasi, die einem beim ersten Blick auf den Buchtitel einfallen. Lügen, Fälschungen, Tarnen und Täuschen, kurz: Desinformation sind Methoden des Terrorismus selbst – und der Geheimdienste von Staaten, die dessen Handeln aus dem Untergrund gern und meist skrupellos ihren Interessen dienstbar machen. Insofern müsste die einstige Abteilung XXII des Mielke-Ministeriums nicht „Terrorabwehr“ sondern eigentlich „Terrorlenkung“ heißen.
Schon nach kurzem Einlesen erstaunte mich die Recherchearbeit, die Regine Igel für ihr Buch geleistet hat. Ein enormes Puzzle von Zeiten, Orten, Personen tat sich auf, zusätzlich kompliziert durch Lücken und Schwärzungen in den Archivalien aus Stasi-Unterlagen, die man ihr beim BStU herauszugeben bereit war. Die größte Komplikation liegt freilich im Wesen der Sache: „Terrorismus-Lügen“ sind mehr als die gängigen Deckmäntel überm Agieren der Stasi, die einem beim ersten Blick auf den Buchtitel einfallen. Lügen, Fälschungen, Tarnen und Täuschen, kurz: Desinformation sind Methoden des Terrorismus selbst – und der Geheimdienste von Staaten, die dessen Handeln aus dem Untergrund gern und meist skrupellos ihren Interessen dienstbar machen. Insofern müsste die einstige Abteilung XXII des Mielke-Ministeriums nicht „Terrorabwehr“ sondern eigentlich „Terrorlenkung“ heißen.









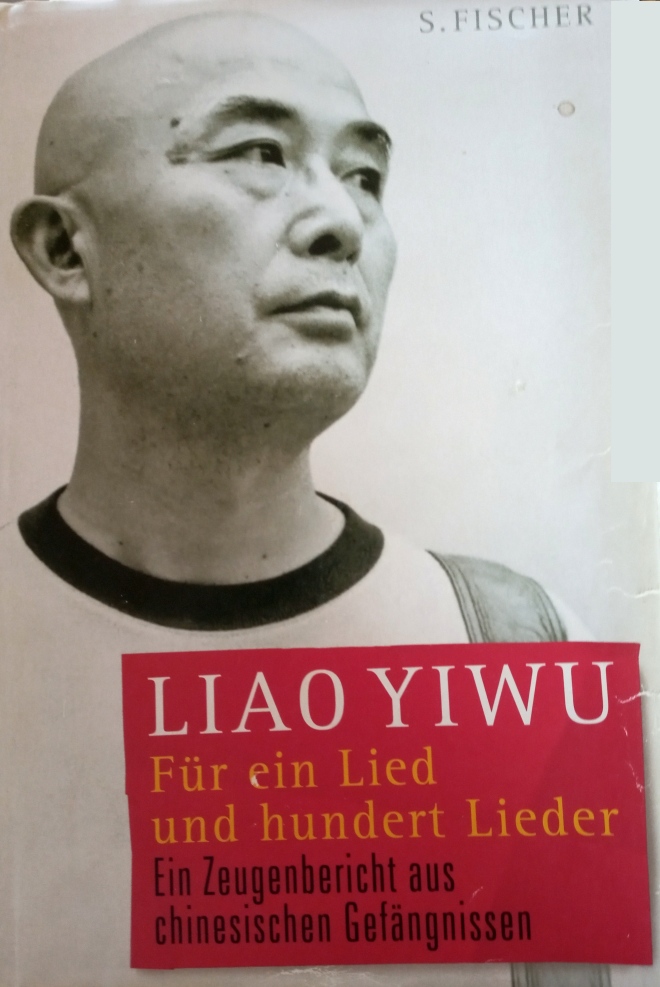
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.